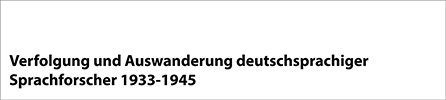Garvin, Paul Lucian
Geb. 28.8.1919 in Wien, gest. 15.5.1994 in Buffalo/N.Y.
Die Aufnahme von P. G. in die deutschsprachigen Sprachwissenschaftler zeigt die Abgrenzungsprobleme. Er stammte aus einer tschechoslowakischen Familie, in der die Familiensprache ungarisch war (die Geburt in Wien geht auf medizinische Vorlieben der Mutter zurück). Schon vor der Schule lernte er Deutsch und ging schließlich in Karlsbad auf eine deutsche Schule, machte sein Abitur 1937 aber auf einer tschechischen Schule. Er begann zunächst in Prag ein Medizinstudium, kehrte 1938 aber von einer Ferienreise nach Italien nicht mehr zurück, sondern reiste unter dem Druck der drohenden rassistischen Verfolgung zu Verwandten nach Schweden (die Eltern emigrierten in die USA). In Schweden verkehrte er insbes. in deutschsprachigen Emigrantenkreisen und begann ein Sprachwissenschaftstudium mit dem Schwerpunkt Finno-Ugristik (bei Steinitz, Lotz u.a.). Da er keinen regulären Studentenstatus erhielt, konnte er keinen Studienabschluß machen, sondern versuchte sich (in Schwedisch) im journalistischen Bereich (er lebte aber überwiegend von Unterstützungsgeldern).
1941 emigrierte er zu den Eltern in die USA (nach New York), wo er anfangs von jüdischen Hilfsorganisationen unterstützt wurde. Über die Vermittlung von Jakobson, den er in Schweden kennengelernt hatte,[1] nahm er sein Studium der Sprachwissenschaft an der französischen Exiluniversität auf (Ecole Libre des Hautes Etudes, New York); er hatte zeitweise auch eine Anstellung in einem Projekt des YIVO (bei Max Weinreich) zur Erforschung des ungarischen Jiddisch[2] (er selbst war als »urbanisierter, westeuropäischer Jude«, wie er selbst betonte, anti-zionistisch und auch gegen den kulturellen Assimilationsdruck des Judentums eingestellt); er war kein Jiddisch-Sprecher und bekam nicht zuletzt auch deshalb in der jüdischen Gemeinschaft der Ostküste, in der er lebte, Schwierigkeiten (er heiratete damals eine Frau aus der jüdisch-jiddischen Gemeinschaft). 1943 wurde er an das Sprachprojekt der Armee in New York (unter Leitung von H. L. Smith) verpflichtet, wo er Wörterbucharbeit für verschiedene slawische Sprachen machte. 1945 machte er seine Licence an der Columbia University.
Nachdem er zunächst bei einem anthropologischen Projekt (über die tschechische Gegenwartskultur) an der Columbia Univ. in New York bei M. Mead und R. Benedict tätig war, ging er nach Bloomington, Indiana, um an einem Projekt zum Russischunterricht für die Luftwaffe mitzuarbeiten. Gleichzeitig nahm er ein Studium der Ethnologie bei Voegelin auf, das er 1947 mit dem Ph.D. auf der Grundlage einer Dissertation über die Sprache der Kutenai abschloß, für die er 1946 mit einem Stipendium Feldforschung im Staat Idaho getrieben hatte.[3] In einer extensiven Artikel-Serie, z.T. auch auf der Basis ergänzender Feldforschungsaufenthalte, hat er diese Studien ausgewertet, angefangen bei der Phonologie, s. »Kutenai I: Phonemics«.[4] Auch in späteren, methodologisch argumentierenden Beiträgen kommt er immer wieder auf diese Studien zurück, so z.B. in seiner exemplarischen Rekonstruktion einer durch »Übersetzung« nicht zu fassenden Kategorie »Obviativ«, einer Art Diathese-Kategorie, die die semantische »Marginalität« einer Nominalgruppe in Subjektfunktion in Hinblick auf die Prädikation des Satzgefüges markiert. Dabei hat er versucht, europäische Analyse-Traditionen mit distributionalistischen Verfahren der US-Linguisten zu vermitteln (»A descriptive Technique for the Treatment of Meaning«).[5]
In seiner eigenen Sicht war seine Situation damals in jeder Hinsicht unangepaßt. Als bewußter »Europäer« stand er in Opposition zu dem amerikanischen Deskriptivismus; dessen Methoden der Sprachbeschreibung mußte er als Autodidakt lernen (bei den Arbeiten mit den Kutenai war er mehr an Boas als an Bloomfield, Pike, Harris u.a. orientiert). Nach der Dissertation übernahm er noch ein weiteres Feldforschungsprojekt zum Ponopei.[6] Diese Arbeiten verschafften ihm 1948 eine Assistenzprofessur für Ethnologie an der Univ. Oklahoma, die er 1951 wegen persönlicher Konflikte aufgab. Nach einer vorübergehenden Arbeitslosigkeit erhielt er eine Assistenzprofessur an der Georgetown Univ. in Washington, wo er in einem Projekt zur maschinellen Übersetzung Englisch-Russisch arbeitete.
Er beschreibt diese Zeit als sehr konfliktreich – in der Fachöffentlichkeit trat er vor allem mit Aufsätzen hervor, die die europäisch-»mentalistische« Tradition reklamieren; s. etwa seinen ausführlichen Rezensionsartikel zu Hjelmslev, »Omkring sprogteoriens grundlæggelse«,[7] in dem er dessen theoretischen Apparat ausführlich im europäischen Kontext diskutiert (der Prager Schule, einschließlich und extensiv Bühler und Jakobson; der Genfer Schule, Martinet u.a.), vor allem aber auf weniger offensichtliche Übereinstimmungen in den Grundprämissen verweist, die jenseits des methodisch Kontrollierten und Explizierbaren der sprachwissenschaftlichen Analyse den Gegenstandsbereich als kulturell definiert begreifen (mit Übereinstimmungen in der kulturanthropologischen US-Tradition und Hjelmslevs Konnotationsanalyse, s. bes. S. 82 u. 88); s. in diesem Sinne auch seinen Nachruf auf Bühler,[8] mit dem er dessen Werk der US-amerikanischen Fachöffentlichkeit überhaupt erst zur Kenntnis brachte. Persönlich fand er damals zu einer souveräneren Haltung vor allem über die Beziehung zu Madeleine Mathiot, die er später auch heiratete (und mit der er gemeinsam publizierte, s.u.). Die Richtungskämpfe der US-Linguistik interessierten ihn nicht, vor allem auch nach dem in seiner Sicht (nach dem Ausscheiden von Uriel Weinreich) Niedergang des New Yorker Linguistenkreises um die Zeitschrift Word. So schied er auch in Georgetown aus und ging 1960 zu Beginn des Computerbooms an die Westküste, wo er bei einem Forschungsinstitut (Bunker Ramo Corp.), zum erheblichen Teil finanziert aus Geldern des militärischen Forschungsetats, Computerlinguistik betrieb.
Er unternahm hier Grundlagenforschung zur maschinellen Übersetzung, wobei er, sowohl gegen technisches »power-play« wie gegen den theoretischen Purismus von Bar-Hillel, Chomsky u.a. gerichtet, für eine strikt ingenieurswissenschaftliche Forschungsarbeit plädierte, die auf empirischer Grundlage spezifische Hypothesen ausbildet,[9] in diesem Rahmen auch zur Entwicklung eines automatischen Verschriftungssystems. Auf der Grundlage von Graphem-Phonem-Korrespondenzen im Englischen versuchte er mit einem stochastischen System von Übergangsrestriktionen für Sequenzen lesbare Lautfolgen auf desambiguierte Wortketten abzubilden – wegen der nicht verfügbaren automatischen syntaktischen Analyse (»Parser«) unter weitgehender Ausschaltung der Syntax, s. etwa (gemeinsam mit E. C. Trager) »The Conversion of Phonetic into Orthographic English: A Machine Translation Approach to the Problem«.[10] In diesem Rahmen arbeitete er an mehreren, eher ingenieurswissenschaftlich designten, auf technische Effizienz ausgerichteten Projekten, z.B. an der Codierung von Paraphrasebeziehungen zwischen Sätzen auf der Basis eines (englischen) Großcorpus von 7500 Sätzen, das eine strikte Operationalisierung semantischer (paradigmatischer) Relationen kombiniert mit syntaktischen (Kollokationen) versuchte.[11] Ergebnisse dieses Projektes hatte er schon 1962 auf einer LSA-Jahrestagung vorgetragen.
In diesem Kontext fühlte er sich jetzt endlich integriert. Als in der zweiten Hälfte der 60er Jahre das bis dahin herrschende Paradigma der maschinellen Übersetzung problematisch wurde (nach dem ALPAC Report, für den er auch angehört wurde)[12] und sich schließlich, ausgehend von der generativen Grammatik, mit der G. sich nicht hat anfreunden können, eine neue »kognitive Orientierung« durchsetzte, zog er sich aus diesem Bereich zurück, s. seine Aufsatzsammlung »On Linguistic Method«,[13] in der er sich als »Funktionalist« und »Operationalist« definiert und eine große ideengeschichtliche Koalition gegen die generative Transformationsgrammatik beschwört, sowie auch vorher schon den von ihm hg. Sammelband »Method and Theory in Linguistics«,[14] für den er 1966 nicht-main-stream-US-amerikanische und europäische Sprachwissenschaftler zu einer Konferenz versammelt hatte. Vergleichbar ist der mit B. Spolsky herausgegebene Band »Computation in Linguistics«,[15] auf der Basis einer in Bloomington 1964 von G. organisierten Konferenz, die in gleicher Weise eher empirisch orientierte Sprachwissenschaftler, Computerlinguisten, im übrigen auch aus Europa bzw. Deutschland, versammelte. Immerhin hatte er aber 1969 noch in einer anderen Konferenz die damalige Prominenz der entstehenden »Künstlichen Intelligenz«-Forschung versammelt – und den von ihm hg. Sammelband »Cognition: A Multiple View«[16] mit skeptischen Bemerkungen über die leere Utopie der Simulation eines universalen Problemlösers bzw. mit einem Plädoyer für ingenieurswissenschaftlich-kongruentere Fragestellungen eingeleitet – womit er sich zugleich aus dieser Debatte verabschiedete. Gerade als computerlinguistisch ausgewiesener Sprachwissenschaftler argumentierte er aber auch noch 1967 bei dem 10. Internationalen Linguistenkongreß in Bukarest gegen den seiner Meinung nach theoretischen Leerlauf der generativistischen Richtung und für eine explizit von ihm in die Bühler-Tradition gestellte funktionale Analyse, die Sprache als kulturelles Phänomen behandelt (»The role of function in linguistic theory«).[17]
Die Klammer für seine Arbeiten in der empirischen Feldforschung wie der maschinellen Übersetzung war wohl ein spezifisches methodologisches Verständnis von Sprachwissenschaft, das diese (in der Tradition von Husserl und Bühler) als operationale Wissenschaft begriff, jenseits eines fundamentalistischen Verständnisses, das die theoretischen Konstrukte realistisch als solche der Sprache selbst versteht. So arbeitete er dann auch seit den späten 60er Jahren an seinem Magnum Opus mit dem Titel »Discovery Procedures: Theory and Practice«, das er aber nicht mehr fertigstellte.[18]
G. praktizierte eine spezifische Symbiose der europäischen strukturalistischen Tradition, für die einerseits die phänomenologische Kritik am psychologischen Realismus Pate gestanden hatte, andererseits die Operationalisierungen in der Gestaltpsychologie (s. Bühler), aufgrund von der er die Operationalisierungen des US-amerikanischen Strukturalismus, also die Identifizierung von Mustern im Sprachverhalten in der Bloomfield-Tradition, auf einen gemeinsamen Nenner bringen konnte. Dieses Verständnis stand auch hinter seinen Arbeiten zur maschinellen Übersetzung.
1969 übernahm er eine Professur für Sprachwissenschaft an der State Univ. in Buffalo, N.Y., wo er vor allem sprachsoziologische Projekte durchführte (z.B. eine ethnographische Untersuchung zur Spracheinstellung gegenüber dem Englischen als Muttersprache in Nordamerika, die in gewisser Weise eines seiner Grundprobleme als Europäer in der US-amerikanischen Gesellschaft spiegelt).[19] Auch dabei ist deutlich, wie sehr er europäische Traditionen der Sprachwissenschaft fortführte, die gerade auch in theoretischen Modellierungen eine Grundlagenforschung für gesellschaftliche Aufgaben der Sprachkultur sahen, insbesondere Fragen der Sprachplanung und der Standardisierung. In diesem Sinne publizierte er nicht nur, sondern war auch aktiv in verschiedenen Planungsgremien und Beratungstätigkeiten. In diesem Sinne publizierte er nicht nur, sondern war auch aktiv in verschiedenen Planungsgremien und Beratungstätigkeiten. Dabei propagierte er ein entsprechendes Verständnis von Soziolinguistik, vor allem auch in Südamerika, wofür z.B., ausgehend von einer Konferenz in Mexiko 1968, ein gemeinsam mit Yolanda Lastra herausgegebener Sammelband »Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística«[20] steht, wie er z.B. auch an einer von der UNESCO in Paris organisierten Konferenz über Mehrsprachigkeit teilnahm.[21]
Seiner Biographie entsprechend nehmen in seinem recht umfangreichen publizistischen Werk Textsammlungen einen großen Raum ein, mit denen er dem US-amerikanischen Fachpublikum europäische (vor allem auch osteuropäische) Traditionen nahezubringen versuchte, so in seinem Überblicksartikel »Czechoslovakia«, in dem (von ihm mit Th. Sebeok herausgegebenen) Band »Soviet and Eastern European Linguistics«,[22] mit dem Fokus auf syntaktischen (»funktionale Satzperspektive«) und soziolinguistischen (Sprachnormierung) Fragen. Einen entsprechenden Quellenband hatte er schon vorher herausgegeben.[23]
In den letzten Jahren suchte (und fand) er wieder den Kontakt zu seiner biographischen wie vor allem geistigen Herkunftsregion. Nach seiner Entpflichtung in Buffalo absolvierte er regelmäßige Aufenthalte in der Tschechoslowakei (Tschechien), und übernahm in den Universitäten in Brno (Brünn) und Prag auch wieder Professorentätigkeiten. In diesem Kontext publizierte er dort auch regelmäßig, vor allem in Festschriften für seine dortigen Kollegen.[24] 1990 verlieh ihm die Universität Brno einen Ehrendoktor. In seiner dort gehaltenen Vorlesung (»Czechoslovak linguistics and the world«)[25] rekapituliert er sein Werk und stellt mit dem Grundkonzept der Sprachkultur, als Fluchtpunkt für eine funktionalistische Begriffsbildung gerade auch in der »Prager Schule«, den Gegensatz zu den US-amerikanischen Traditionen heraus.
Q: DAS; Bronstein u.a. 1977; Interview mit P. G. 1985; Nachschrift eines Interviews von Einar Haugen mit P. G. 1954, Ms.[26] Nachrufe: Matthew S. Dryer in: Linguist List 5.579 v. 21.5.1994; Pierre Swiggers in: Orbis 38/1995: 369-375; František Daneš in: International J. of the Sociology of Language 118/1996: 205-207.
[1] Jakobson hatte zwar auch eine Professur in Brno (Brünn), von wo er im März 1938 emigrierte, aber G. hatte in dieser Zeit nach eigenen Aussagen noch keine Vorstellungen von Sprachwissenschaft.
[2] S. auch noch die spätere Publikation »The Dialect Geography of Hungarian Yiddish«, in U. Weinreich (Hg.): »The Field of Yiddish II«, Den Haag: Mouton 1965.
[3] Kutenai ist eine Indianersprache, die noch von einer Gruppe von ca. 500 Personen in Idaho und Montana in den USA bzw. British Columbia in Kanada gesprochen wird, die seit den ersten Studien dazu von F. Boas klassifikatorische Probleme aufgeworfen hat.
[4] In: Int. J. Amer. Ling. 14/1948: 37-42.
[5] In: Lg. 34/1958: 1-32. Für eine Würdigung seiner Kutenai-Arbeiten s. jetzt M. S. Dryer, »Grammatical relations in Ktunaxa (Kutenai)«, Winnipeg: Voices of Rupert’s Land 1996.
[6] Auf einem Atoll in Mikronesien (mit einer US-Militärbasis) gesprochen, wo die US-Marine sprachwissenschaftliche Analysen als Grundlage für den Aufbau eines Schulsystems brauchte (Vereinheitlichung des Schriftsystems, Auskunft über sprachsoziologische Verhältnisse).
[7] Kopenhagen 1943 [die englische Übersetzung erschien erst später: Madison 1963] in: Lg. 30/1954: 69-96.
[8] In: Lg. 40/1964: 633-644.
[9] S. »On Machine Translation«, Den Haag: Mouton 1972 – übrigens auch hier passim mit Verweisen auf die europäische Traditionen (zu Bühler etwa S. 66 u. 68).
[10] In: Phonetica 11/1964: 1-18.
[11] Mit. J. Brewer, M. Mathiot, »Predication-typing: A pilot study in semantic analysis«, Supplement-Heft zu Lg. 43/1967.
[12] S. Pierce 1966: 19ff. und bei Bar-Hillel und Oettinger.
[13] Den Haag: Mouton 1972.
[14] Den Haag: Mouton 1970.
[15] Bloomington: Indiana UP 1966.
[16] New York: Spartan 1970.
[17] In: »Actes du Xe Congrès International des Linguistes«, Bukarest 1969, Bd. 1: 287-291.
[18] S. die Hinweise im Nachruf von Swiggers (Q): 371.
[19] Über dieses Projekt berichtete er 1985 in Osnabrück. Dem spezifisch anglo-amerikanischen Pragmatismus in Sprachfragen kontrastiert er die emotionale Bindung an die eigenen Sprache (als »treasure« [Schatz]) der Sprachgemeinschaft bei den Frankokanadiern.
[20] Mexico: UNAM 1974.
[21] S. F. Lo Jacomo (Hg.), »Plurilinguisme et communication«, Paris: SELAF 1986, darin von G.: »Quelques observations sur le plurilinguisme officiel«, S. 183-189.
[22] Bd. I der »Current trends in Linguistics«, Den Haag: Mouton 1970: 499-522.
[23] Ergänzt um einen Band zu den literarisch orientierten Arbeiten. »A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style«, Washington D.C.: Georgetown UP 1964.
[24] So in J. Mey (Hg.), »Language and Discourse: Test and Protest. A Festschrift for P. Sgall«, Amsterdam: Benjamins 1986, darin von G.: »Semiotic aspects of Machine Translation«, S. 555-563 (mit systematischem Rückgriff auf Bühler) und in S. Čmejrková/F. Štícha (Hgg.), »The syntax of sentence and text. A Festschrift for F. Daneš«, Amsterdam: Benjamins 1994, darin von G.: »Karl Bühler’s Field Theorie in the Light of the current interest in Pragmatics«, S. 59-66.