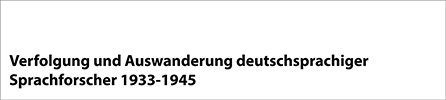Baader, Theodor Ludger
Geb. 25.4.1888 in Münster/Westf., gest. 16.4.1959 in Hiltrup b. Münster.
Nach dem Abitur 1910 in Münster dort Studium der Germanistik, vergl. Sprachwissenschaft und Geschichte. 1913 Promotion (Datum des Rigorosums, Dissertation: »Historische Übersicht des osnabrückisch-tecklenburgischen Vokalismus«; Betreuer war Jostes).[1] 1914-17 Kriegsteilnahme, 1917 in Frankreich in Gefangenschaft, von Kriegsende bis Juni 1919 in der Schweiz interniert. Während des Zwangsaufenthaltes in der Schweiz unterrichtete er an der Deutschen Auslandsschule in Bern und setzte dort sein Studium fort, wo er vor allem wohl bei Jaberg die Methoden der modernen Dialektologie kennenlernte. Nach der Rückkehr nach Münster stellte ihn Jostes am Westfälischen Wörterbuch ein; 1920 legte er das Staatsexamen ab und habilitierte zugleich an der Universität.[2]
1923 erhielt er die Professur für Sprachwissenschaft des Deutschen an der neugegründeten katholischen Universität Nijmegen; dafür waren wohl nicht zuletzt konfessionelle Gründe maßgeblich (s. van Gemert, Q). Er hatte das Fach in seiner ganzen Breite, mit Einschluß der Mediävistik zu vertreten und dabei einen besonderen Lehrauftrag auch für Keltisch (im Rahmen der Anglistikausbildung gefordert).[3] 1936-1937 fungierte er als Rektor. Nach der Besetzung der Niederlande agierte er offen im Sinne des Besatzungsregimes, involviert auch in universtätsinterne Querelen (s. van Gemert, Q). Das drückt sich auch in seinen Publikationen aus dieser Zeit aus, in denen er »rassenkundliche« Akzente setzte, so in »Het ras in de Duitsche dichtkunst«,[4] wo er sich die Auffassungen zur »Rassenseele« von H. F. K. Günther und L. F. Clauss zueigen macht und sich auf Rosenbergs »Mythus«[5] beruft, aber auch W. Schmidts kritische Position aufführt.[6] Nach dem Vorrücken der alliierten Armee in den Niederlanden im Herbst 1944 floh er nach Deutschland, wo er seitdem als Privatgelehrter auf seinem heimatlichen Hof in Hiltrup (heute in der Stadt Melle eingemeindet) weiterarbeitete.Nach dem Krieg entließ ihn die Universität Nijmegen wegen wangedrag en plichtverzuim (»ungebührlichem Verhalten und Pflichtversäumnis«).
Für seinen Zugang zu Sprachproblemen war offensichtlich seine Musikalität bestimmend (der umfangreiche Nachlaß liegt im Archiv des Westf. Wörterbuchs in Münster; dort finden sich auch zahlreiche musikalische Arbeiten: eigene Kompositionen u. dgl.). Seine Arbeiten sind bestimmt von einer hyperdetaillierten Transkription vor allem auch im prosodischen Bereich (für den er auch musikalische Notationsweisen zuhilfe nimmt). Dabei teilen seine Arbeiten das Schicksal von Sievers’ Schallanalyse - in der Zunft kann ihm kaum jemand in seinen subtilen Unterscheidungen folgen. Die (ohren-)phonetische Genauigkeit ist für ihn der Ansatzpunkt einer neuen Sprachwissenschaft, s. in diesem Kontext seine »Einführung in die Lautschrift und instrumentelle Sprachregistrierung«.[7]
Im Horizont von artikulatorischer/auditiver und akustischer/instrumenteller Phonetik diskutiert er dort die Bandbreite von »enger« und »weiter« (typisierender) Umschrift und beklagt die Zwänge der typographischen Beschränkungen beim Druck. So gliedert er sein Material in der Dissertation (und auch in späteren Arbeiten) nach den registrierten phonetischen Typen, die er sekundär nach regionaler Verbreitung und dann nach etymologischer Genese ordnet - also strikt gegenläufig zur etymologischen Anlage »junggrammatischer« Arbeiten.[8] Aus dem gleichen Grund ist für ihn der indirekt aufgrund von Laiennotierungen erstellte »Deutsche Sprachatlas« weitgehend unbrauchbar. Sein Lebensprojekt war ein eigenes Atlaswerk für den westfälischen Raum, zu dem er von Münster aus systematisch Umfragen vornahm und in seiner Habilitationsschrift wie auch in dem ebenfalls nur handschriftlich nachgelassenen Werk »Laut- und Formenlehre der osnabrückisch-tecklenburgischen Mundarten« (ca. 1920 - in seiner Habilitationsschrift bezieht er sich darauf als auf seine »Grammatik«) schon eine ganze Reihe von Karten mit Isoglossen vorlegte,[9] mit einer sehr detaillierten kleinräumigen Ausgliederung.[10] Dieses Werk betrieb er planmäßig auf seiner niederländischen Professur weiter: Sein größtes in dieser Zeit entstandene Werk betrifft das niederdeutsche (im Kontinuum zum Westfälischen stehende) ostniederländische Dialektgebiet von Twente, zu dem er auf der Basis einer Heimatmundart-Monographie seines Doktoranden Ribbert eine dreiteilige Monographie vorlegte »Phonologie des Dialektes von Tilligte in Twente«.[11] In Band I skizzierte B. sein Konzept von Dialektologie als »Soziallinguistik«, wobei er die sozial-kulturellen Bindungen dieses Raumes an die Region jenseits der Landesgrenze dokumentiert, in Band II versucht er mit den Kriterien einer »internen Rekonstruktion«, die vor allem Variationen in den Daten verschiedener Sprecher (aus verschiedenen Generationen) analysiert, eine Extrapolation der Dynamik der Sprachentwicklung, die die Verhältnisse im Großraum erschließt. Ein dort angekündigter Folgeband zur »gesamttwentischen Dialektgeographie und Lexikographie« ist nicht mehr erschienen.
Auch seine späteren Veröffentlichungen als »Privatgelehrter« stehen in diesem Horizont, wo er mit den technischen Mitteln moderner Tonbandaufzeichnungen die Materialerhebung für den von ihm geplanten Atlas fortsetzte, s. etwa seinen (mit Dialektkarten illustrierten) Beitrag zu dem Mundartraum Lingen[12] sowie seine monographische Darstellung zu »Voxtrup. Kreis Osnabrück« in der »Lautbibliothek der deutschen Mundarten«.[13]
B.s genuiner Beitrag ist wohl der Ausbau der Sieversschen Silbenschnitttheorie: Er geht von einem eigenen phonetischen Parameter artikulatorischer Intensität aus (»crescendo« /»decrescendo«), dessen Werte allerdings tendenziell Einfluß auf andere Parameter nehmen: zunehmende Intensität der Artikulation in der Silbe: Kürze des Vokals, fester Anschluß des Vokals an den folgenden Konsonanten, Silbengrenzen im auslautenden Konsonanten und evtl. Gemination; abnehmende Intensität: Länge, evtl. Dehnung des Vokals, loser Anschluß. Bei beiden Typen ist eine qualitative Differenzierung des Vokals möglich: bei »crescendo« öffnender (»Brechungs-«)Diphthong, mit der größten Intensität im zweiten Teil mit der größeren Schallfülle (»Tiefdiphthong«), bei »decrescendo« schließender Diphthong (»Hochdiphthong«).[14] Ebenfalls gut Sieverssch koppelt er diese Typen (oder doch unterschiedliche Präferenzen für diese Typen) an verschiedene »Artikulationsbasen«, die dann auch »rassisch« bedingt sein können (auch im Westfälischen gibt es für ihn verschiedene Artikulationsbasen, so in der Habilitationsschrift).[15] Detailliert (auch mit einer Fülle graphischer Veranschaulichungen) ist in diesem Sinne auch die Darstellung des Twenteschen Dialekts (bes. Bd. I), wobei sich Ribbert dort auf die methodischen Vorgaben von B.s entsprechenden Vorlesungen in Nijmegen beruft.
Auf dieser Grundlage hat B. später etwas monoman geglaubt, eine Lösung für die meisten Probleme der historischen Phonologie zu haben - auch weit über die germanische Sprachfamilie hinaus, s. etwa »Der Intensitätsverlauf des germanischen Akzentes«,[16] wo er eine »eigene Theorie« zur germanischen Lautverschiebung skizzierte. Er hatte ein System von »Eigentonsystemen« entwickelt, das er an die Stelle der damals üblichen Argumentation mit Artikulationsbasen stellen wollte: Eine spezifische Charakterisierung der dominanten Verhältnisse des Ansatzrohres in der sprachspezifischen Lautproduktion, die recht direkt mit physikalischen Bedingungen der Sprachperzeption (feuchtes/trockenes Klima, niedriger/hoher Luftdruck u. dgl.) korrelieren sollte. So konnte er gewissermaßen »ableiten«, in welchen Räumen welche Eigentonsysteme zuhause waren.[17] Da er diese Konstruktion mit sehr spezifischen phonetischen Aussagen koppelte, postulierte er solche apodiktisch auch für die vor- und frühgeschichtlichen Sprachsysteme: Für die im Seeklima wohnenden Germanen ein System mit Frikativen - anders als bei den kontinentalen Indogermanen. Die sog. zweite Lautverschiebung war für ihn folgerichtig keine indogermanische Sprachentwicklung, sondern der Spiegel der (nicht-indogermanischen) Sprachstruktur der Germanen nach ihrer Unterwerfung/»Indogermanisierung«.
Er entfaltete eine ungemein rege Publikationsaktivität, vor allem in den dialektologischen Zeitschriften (Theutonista, Z. f. dt. Mundarten u. a.), in denen er seine Überlegungen zur Dialektgliederung des Westfälischen vortrug, immer mit recht originellen Ansätzen, die Beobachtungsakribie mit ungehemmter Freude am transhistorischen »Durchgriff« zu archaischen Sprachstrukturen verdoppelte (im Westfälischen, einschließlich der ostniederländischen Region entdeckte er so ein anglo-friesisches Struktursubstrat, s. auch seinen o. g. »Lingen«-Beitrag). Dabei war er jeweils bemüht um breitgestreute Vergleiche auch mit recht entlegenen Sprachen. Systematisch hat er seine Vergleiche im Rahmen der germanischen Sprachwissenschaft ausgebaut, wo er auch Studien zum Gotischen und Altnordischen vorlegte.
Er begriff sich dabei aber nie als »provinzieller« deutscher Dialektforscher - abgesehen von den von ihm angeführten Vergleichsbeispielen, oft aus recht entlegenen Sprachen, bemüht er immer extensiv die neueste internationale Literatur (in der deutschen, erst recht in der niederdeutschen Dialektologie war er damit ein Unikum!); in seiner Habilitationsschrift bezog er sich vor allem auf die französische Schule, und zwar nicht nur deren phonetische Richtung (Rousselot), sondern skizzierte explizit die »sociologie linguistique«, von Gilliéron bis Meillet als sein Bezugssystem. Seine Ambitionen gingen weit über die Dialektologie hinaus. So produzierte er ein ausführliches Werk »Die identifizierende Funktion der ich-Deixis im Indogermanischen« (1929), das Meillet aufgrund der offensichtlich unzureichenden Kenntnisse des angeführten griechischen, indischen, armenischen Materials mit der lakonischen Bemerkung qualifizierte: »Simple erreur à négliger«.[18]
In diesem Feld hatte er noch größere Ambitionen: in »Aus einer Sprachlandschaft Alteuropas«[19] kündigte er ein großes Werk an, das die Spuren der vorindoeuropäischen Verhältnisse in den Substratwirkungen in den jüngeren Sprachen rekonstruieren will, hier am Beispiel einerseits des thrakischen Substrats im Gotischen auf dem Balkan gegenüber dem etruskischen Substrat bei dem späteren Gotischen in Oberitalien.
B. lag offensichtlich quer zu allen zeitgenössischen diskursiven Formationen. Sein »Fundamentalismus« zeigt Übereinstimmungen mit völkischen Argumentationsstrukturen (emphatisch zitiert er in Bd. III/1939 der Twente-Monographie Fritz Stroh und Georg Schmidt-Rohr, s. in der Einleitung), richtete sich aber explizit gegen rassistische Ansichten (mehr oder weniger deutlich so gegen »nordische« Auffassungen der »Germanenfrage« in dem o. g. Aufsatz über das germanische Konsonantensystem von 1939). Hier hatte er auch keine Berührungsängste gegenüber entsprechend fundamentalistischen Institutionen; so publizierte er z.B. als Parallele zu entsprechenden Sprachursprungsspekulationen über Schnalzlaute in den germanischen Sprachen bei der »Deutschen Gesellschaft für Tier- und Ursprachenforschung«. In diesem Umfeld war er allerdings bemerkenswert positivistisch (und wurde daher auch von dem Vorsitzenden der Gesellschaft, G. Schwidetzky, in einer Nachbemerkung »korrigiert«). Gelegentlich sind bei B. aber doch auch Homologien zur Argumentationsfigur des »Rassestils« deutlich, wenn er eine romanische und germanische Geisteshaltung (»germaanse geesteshouding«) transhistorisch ausgerechnet auch bei »Grenzland«-Problemen reklamiert (etwa den Straßburger Gottfried emphatisch in eine »duitse stad« versetzt), so ausgerechnet in seiner Nijmegener Rektoratsrede von 1936.[20] Seine eigenwillige Position in der deutschen Sprachwissenschaftsszene zeigt sich auch in der Art, in der er sich an den phonologischen Debatten der Zeit beteiligte, auch im direkten Kontakt mit dem Prager Linguistenzirkel.[21] In der Gedenkschrift für Trubetzkoy (Bd. 8/1939 der »Travaux«) hat er dort einen Beitrag zur Rekonstruktion des germanischen Konsonantensystems publiziert.
Eine Ausnahme in der deutschen Sprachwissenschaftsszene war B. auch, indem er sich an den phonologischen Debatten der Zeit beteiligte, wo er Beiträge zu Fragen der diachronen Phonologie zu den »Travaux« des Prager Linguistenzirkels beisteuerte (u. a. der Beitrag zur Rekonstruktion des germanischen Konsonantensystems in Bd. 8/1939, der Gedenkschrift für Trubetzkoy). Die von ihm dabei herausgestellte Abgrenzung von der tradierten akademischen Tradition in Deutschland kontrastiert mit seiner beschränkten Einsicht in die methodologischen Konsequenzen des Strukturalismus (was er mit anderen Teilnehmern dieser Debatte teilte, s. bei Bühler und Trubetzkoy). Das Phonem ist für ihn eine »Lautvorstellung«, auf die er gewissermaßen spekulativ direkt Zugriff hat - man vermißt gerade auch in den materialreichen Darstellungen wie der Monographie zu Twente jede operationale Kontrolle der phonologischen Typisierungen. In diesem Sinne eignete er sich auch, ansonsten bemerkenswert aufgeschlossen, Trubetzkoys Konzept der »Morphonologie« an (s. den dazu bestimmten Twente-Bd. II/1938). Die von ihm gesehene (und an seine Schüler weitergegebene!) Notwendigkeit, sich mit den neueren Entwicklungen auseinanderzusetzen, ist für sich genommen bemerkenswert. Trotzdem ist für seine eigenen Arbeiten typisch, was er als letzte Arbeit vorgelegt hat, eine Mundartaufnahme in der von Zwirner[22] eingerichteten »Lautbibliothek der deutschen Mundarten«: »Voxtrup. Kreis Osnabrück« (s. Fn. [12]). Extrem »eng« transkribiert, bes. in Hinblick auf Satzphonetisches und Silbenschnittprobleme, mit einer Fülle von historischen und dialektgeographischen Anmerkungen - aber ohne Spur phonologischer Analyse.
Seine verquere Stellung in der Fachöffentlichkeit spiegelt sich in seiner Festschrift:[23] Bis auf drei kommen alle Beiträge aus dem niederländisch-flämischen Raum - die drei deutschen Beiträge sind nicht sprachwissenschaftlich. Bei der Tabula gratulatoria ist das noch deutlicher: außerhalb des niederländischen Sprachraums werden nur wenige genannt, in Deutschland vor allem zahlreiche Familienangehörige und private Bekannte - die internationale Fachöffentlichkeit ist aber durch Phonetiker wie Menzerath, Selmer (Oslo) und immerhin A. Basset (Berberforscher, Algier), V. Brøndal (Kopenhagen), A. Sommerfelt (Oslo) vertreten.
Q: V; Kürschner; DBE 2005; IGL (C. Janssen); G. van Gemert, Von Kosch bis Kluge. Achtzig Jahre Germanistik in Nijmegen, in: T. Naaijkens (Hg.), »Rückblicke, Ausblicke. Zur Geschichte der Germanistik in den Niederlanden« (= Utrechter Blätter. Research Review on German Language and Literature, 1), Utrecht: Igitur 2009: 121-140. Hinweise von H. Niebaum u. G. Müller (Archiv des Westf. Wörterbuchs).
[1] Gedruckt erst 1920, Münster: Aschendorff.
[2] Die Habilitationsschrift: »Zur Dialektgeographie Westfalens« ist eine Ausarbeitung seiner in diesem Jahr publizierten Dissertation, s. FN [1]. Sie ist jetzt mit der Dokumentation der Dissertation von H. Niebaum wieder zugänglich gemacht worden: https://www.mundart-kommission.lwl.org/media/filer_public/b6/1a/b61af026-b731-41e0-b7e9-a59ab8b26ce3/baader_dialectgeographie_1920_2020.pdf (abgerufen am 10.7.2010). Teile bzw. (handschriftliche) Vorarbeiten finden sich als Kopien im Archiv des Dt. Sprachatlas, Marburg. Darauf stützten sich ältere Darstellungen (auch meine eigenene).
[3] Nach Janssen (Q) war die Denomination »Keltische und Germanische Sprach- und Literaturwissenschaft (außer der hochdeutschen Literaturwissenschaft und der neuenglischen Sprach- und Literaturwissenschaft)«.
[4] In: De Schow: tijschrift gewijd aan het kultureele leven in Nederland 3/1944: 268-292, 379-385. Der geplante dritte Teil ist wohl nicht mehr erschienen, die Zeitschrift wurde nach dem Erscheinen des Bandes 5/1946 eingestellt.
[5] Rosenberg, Alfred, »Mythus des 20. Jahrhunderts«, München: Eher 136. Aufl. 1938 (Erstveröffentlichung 1930).
[6] Eine besondere Untersuchung wäre hier nötig zu B.s katholischer Einbindung - die sicher auch ein Argument für die Berufung an die »Katholische Universität« Nijmegen war. Sein Förderer (außer dem nicht weniger katholischen Doktorvater Jostes in Münster) war der niederländische Jesuitenpater und Professor van Ginneken, den er in entsprechendem Kontext auch würdigte (in der mir leider nicht zugänglichen Zeitschrift Die Gerade Linie. Zeitschrift für den katholischen Menschen, Berlin, Jg. 1937). Sein wichtigster Schüler war der Karmeliter-Pater Thomas Ribbert (s.u.). Zu weiteren Einbindungen in Katholische Organisationen s. Janssen (Q).
[7] Nijmegen: Centrale Druckerei 1933 - als Grundlage für die von ihm dort initiierten Studien, die wie dieser Band in der von ihm hg. Reihe »Disquisitiones Carolinae. Fontes et Acta Philologica et Historica« erschienen, hier Bd. III.
[8] Eine für B. allerdings nicht evidente Analogie besteht hier zu der gleichen Art unorthodoxer »Synchronie« bei E. Lewy.
[9] Beide Arbeiten liegen in Kopie im Archiv des Deutschen Sprachatlas in Marburg.
[10] Diese weicht im übrigen gerade auch von den von der Münsteraner Arbeitsstelle des Westfälischen Wörterbuchs (Niebaum, Wortmann u.a.) in den letzten Jahren aufgrund der DSA Befunde publizierten Gliederungen und Karten beträchtlich ab (B.s Nachlaß ist erst Ende der 70er Jahre in Nijmegen wieder zugänglich geworden; Hinweis von H. Niebaum).
[11] Alle erschienen in der erwähnten Reihe »Disquisitiones« (Nijmegen: Centrale Druckerei), Bd. I/1933, Bd. II/1938, Bd. III/1939 (Bd. I und II gemeinsam mit R.).
[12] In: »Der Landkreis Lingen«, Bremen: Dorn 1954: 234-242.
[13] Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1961 - also postum.
[14] S. bes. »Der Intensivierungsverlauf des germanischen Akzents«, in: »Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jaques van Ginneken", Paris 1937: 231-255.
[15] Im Sinne dieser Überlegungen hat auch Trubetzkoy in seinen »Grundzügen« (1939) argumentiert. Mangels angemessener instrumenteller Meßverfahren sind sie in der apparativen Nachkriegsphonetik außer Mode gekommen; mit den flexibleren neueren Geräten sollte versucht werden, sie für die derzeitige sprachwissenschaftliche Diskussion wieder zurückzugewinnen (s. z.B. Maas/Tophinke 1991).
[16] In: »Mélanges de linguistique et de philologie offerts à Jaques van Ginneken«, Paris 1937: 231-255.
[17] S. etwa noch »Die Vermischung gegensätzlicher Eigentonsysteme im Germanischen«, in: »Akten des 3. Internationalen Phonetik Kongresses«, 1938: 364-72.
[18] Bull. Soc. Ling. Paris 30/1930: 52-53.
[19] FS J. Schrijnen 1929: 311-316.
[20] »Middeleuwse Geestestypen«, Nijmegen: Dekker & van de Vegt, vgl. bes. S. 20 u. 25. Im übrigen ist das wohl seine einzige explizit mediävistische Publikation.
[21] S. dazu Ehlers (2005).
[22] Eine andere marginale Figur des Prager Kreises.
[23] »Album Philologicum voor Prof. Dr. Th. B.«, Tilburg: Beuken 1939